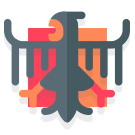Zur Zvilrechtshaftung versammlungs- und/oder strafrechtswidriger Straßenblockaden
Die verkehrsbehindernden Versammlungen des Klimakollektivs "Letzte Generation" sind dieser Tage in aller Munde. In der juristischen Diskussion sticht vor allem die - wiederbelebte - strafrechtliche Diskussion rund um den Gewaltbegriff des § 240 Abs. 1 StGB und der (bloß scheinbar?) gefestigten Zweite-Reihe-Rechtsprechung des BGH, wonach die Blockierer durch den mittelbar-täterschaftlichen Einsatz der ersten Reihe an Fahrzeugen körperlich wirkenden Zwang ausüben, hervor. In der Tat sind die maßgeblichen Grundsätze zur Rechtswidrigkeit der Nötigung und den versammlungspolizeilichen Eingriffsbefugnisse weitgehend geklärt. Größere, vor allem schadensrechtliche Probleme, können demgegenüber bei der Frage nach einer zivilrechtlichen Deliktshaftung der Täter auftreten. Diese Grundfragen sollen in diesem Beitrag angerissen werden.
I. Haftungsbegründendes Verhalten
Anknüpfungspunkt jedes Delikts ist ein Verhalten in der eigenen Person, sei es durch Tun oder Unterlassen. Unter den Voraussetzungen des § 830 Abs. 1 S. 1 BGB findet aber auch eine Haftung für fremdes Verhalten statt, die sich aus einem eigenen deliktsrechtswidrigen Beitrag des Mittäters legitimiert. Das maßgebliche Geschehen muss hierfür vom Täterwillen getragen und in den Vorsatz der Täter aufgenommen worden sein. Dass der einzelne Demonstrant schon körperlich außerstande ist, eine ganze Straße alleine zu blockieren, ist also unschädlich. Schon das gemeinschaftliche Zusammenwirken im Sinne funktioneller Tatbeitragserbringung kann eine Delitkshaftung begründen. Sorgfältig sind jedoch für jedes einzelne Delikt die Voraussetzungen der Mittäterschaft gesondert zu prüfen. Denn der mittäterschaftliche, vom Vorsatz umfasste, Tatplan darf sich nicht in einem abstrakten, außerdeliktischen Ziel oder der bloßen Tätigkeit als solcher erschöpfen. Auch die jeweils verletzten Rechtsgüter müssen in den Tatplan aufgenommen werden.
II. Rechtsgutsindifferente Haftungsgrundlagen
Wenig Probleme ergeben sich tendenziell, bejaht man die Voraussetzungen des § 826 BGB. In Abgrenzung zu den sonstigen deliktsrechtlichen Haftungsgrundlagen ist eine konkrete Rechtsgutsverletzung nicht erforderlich. Die Verursachung jedes Schadens im Sinne von §§ 249 ff BGB reicht hin, wenn dieser vorsätzlich und in einer das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden Weise verursacht wird. Einen eigenen haftungsausfüllenden Tatbestand kennt diese Norm nicht und werden auch Fragen nach dem Schutzzweck der verletzten Verhaltensnorm obsolet. Die Haftung rechtfertigt sich alleine aus der vorsätzlich-sittenwidrigen Schadenszufügung. Vorsatz meint Wissen und Wollen der Schadenszufügung. Vielfach wird das voluntative Element des Vorsatzes dahingehend missverstanden, dass es auf - praktisch nicht feststellbare - innere Haltungen des Täters ankomme. Umschrieben wird dies mit Formeln wie dem Billigen im Rechtssinne oder dem Vertrauen auf einen guten Ausgang. Auch dolus eventualis setzt die willentliche Tatbestandsverwirklichung voraus. Das Wollen des Täters kann aber nicht im alltagssprachlichen Sinne, sondern nur im Rechtssinne verstanden werden. Auch wer nur die Tatbestandsverwirklichung als sicher voraussieht, ohne diese "zu wollen" (sog. dolus directus zweiten Grades), will die Tat, weil er trotz dieser Einsicht gehandelt hat. Mit der Behauptung, er habe die Tat nicht gewollt, kann er vor Gericht dann nicht mehr gehört werden. Nicht anders verhält es sich, wenn die Tatbestandsverwirklichung nicht als sicher, sondern nur als wahrscheinliche oder doch zumindest mögliche Folge des eigenen Handelns vorhergesehen und wider dieser Einsicht gehandelt wurde. Die wenigsten Geschehensabläufe kann man mit der erforderlichen Sicherheit vorhersehen; ein Wissen um zukünftige Umstände kann es in diesem Sinne bei strenger Betrachtung ohnehin nicht geben. Ob man dieses Verständnis des Vorsatzes mit Puppe als Vorsatzgefahr begreift oder mit der Rechtsprechung als Frage tatrichterlicher Beweiswürdigung ansieht, braucht hier nicht diskutiert zu werden. Entscheidend ist nur, dass es nach Art und Umfang der Tat(en) und allgemeiner Lebenserfahrung als von den Tätern wahrscheinlich bewertet wurde, dass ein Schaden entsteht. Dies reicht für die vorsätzliche Schadenszufügung aus.
1. Verdienstausfallschäden (§ 252 BGB)
Bekanntermaßen wird der Straßenverkehr benutzt, um Arbeitsstellen zu frequentieren oder geschäftliche Termine wahrzunehmen. Nachdem der Arbeitnehmer nach allgemeiner Ansicht das Wegerisiko zu tragen hat, kann bei wiederholtem Nicht- oder Späterscheinen durchaus eine zumindest personenbedingte Kündigung erfolgen. Es ist daher zu überlegen, ob der Unterschiedsbetrag zum Arbeitslosengeld von den Straßenblockierer zu tragen ist. Hierbei stellt sich das besondere Problem, dass eine solche Kündigung allenfalls bei wiederholtem Späterscheinen möglich ist (a.). Anders gelagert sind die Probleme um Geschäftstermine. Hier genügt bereits die ein- und erstmalige Blockade des Autofahrers zur Schadensverursachung. Problematisch ist dabei, ob die groben Umstände des Schadens in den Vorsatz aufgenommen worden sind (b.).
a) Blockadeursächliche Kündigung des Arbeitnehmers
Kausal für die Schadensentstehung ist die auch nur einmalige Blockade nach den Grundsätzen kumulativer Kausalität, wenn das blockadeursächliche Späterscheinen entweder der "Tropfen" ist, "der das Fass zum Überlaufen gebracht hat" oder zum Überlaufen des Fasses beigetragen hat. Früheres sowie späteres Nicht- oder Späterscheinen unterbricht den Zurechnungszusammenhang nicht. Bei verschiedenen Deliktstätern, die einander nicht zurechenbare Beiträge erbringen, ergibt sich eine gesamtschuldnerische Haftung schon aus § 840 Abs. 1 BGB. Dies betrifft insbesondere gleichartige Blockaden des Kollektives "Letzte Generation" zu späteren Zeitpunkten in örtlicher Nähe zueinander. Der Vorsatz muss nämlich schon bei der Tatbegehung gefasst worden sein. Freilich ergeben sich - nach diesseits vertretener Auffassung - nicht überwindbare Probleme im Hinblick auf die Vorsatzfeststellung. Ob eine von der Blockade betroffene Person entweder schon früher der Arbeit ferngeblieben ist oder später fernbleiben wird und die Straßenblockade daher das zuvor nur latent vorhandene Risiko einer Kündigung aktiviert, entzieht sich der Kenntnis der Deliktstätern. Äußerst zweifelhaft scheint auch die Annahme, es entspreche allgemeiner Lebenserfahrung, dass auf einem Streckenabschnitt eine bestimmte Anzahl von Personen davon bedroht ist, aufgrund morgendlichen Späterscheinens gekündigt zu werden. Dies ist letztlich bloßer Zufall. Ebenso zufällig sind die Umstände der Schadensentstehung, die nicht zuletzt auch abhängig ist von dem guten Willen des Arbeitgebers. Es liegen nach diesseitiger Rechtsansicht keine Umstände vor, die das Urteil einer überwiegenden Schadenswahrscheinlichkeit tragen können, welche den Tätern den Einwand abschneiden, den Schaden nicht gewollt zu haben.
b) Sonstiger entgangener Gewinn
Diese Grundsätze lassen sich auch auf sonstige Verdienstausfallschäden übertragen. Hierfür streitet zwar nicht, dass den Tätern die Schadenshöhe nicht bekannt ist, denn dies ist gemeinhin nicht erforderlich. Doch müssen jedenfalls die groben Umstände der Schadensentstehung in den Vorsatz aufgenommen werden. Abgesehen von typisierten Fallgruppen von blockadebedingten Verdienstausfallschäden wie unter a) beschrieben, sind die verschiedenen Möglichkeiten des entgangenen Gewinns viel zu unterschiedlich, als dass man den Deliktstätern den Einwand abschneiden könnte, den Schaden nicht gewollt zu haben. Es bleibt lediglich ein, in der Praxis indes nur bedingt relevanter, Schadensposten, der jedenfalls zu ersetzen ist: der unmittelbare Verdienstausfall, den etwa der Arbeitnehmer aufgrund der synallagmatischen Verknüpfung von Arbeit und Lohn gem. § 326 Abs. 1 BGB erleidet. Zahlt der Arbeitgeber, wie es häufig aufgrund der für einen Abzug erforderlichen Buchungskosten in der Praxis geschehen wird, trotzdem den vollen Lohn aus, ist eine Vorteilsanrechnung jedenfalls nicht vorzunehmen. Die rechtsgrundlose Lohnleistung ist als freiwillige Leistung Dritter zu werten, die dem Schädiger nicht zugute kommen darf. Im Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist gegebenenfalls nach den §§ 326 Abs. 4, 346 Abs. 1 BGB zu verfahren.
2. Unfall- und Unfallfolgeschäden
Weniger durch den Zeitverlust und mehr durch das ordnungswidrige Betreten der Straße können Unfallschäden, insbesondere Auffahrunfälle wegen des plötzlich erforderlichen Bremsvorgangs, entstehen. Diese werden von den Deliktstätern, je nach Situation, durchaus eventualvorsätzlich verursacht. Die Annahme vorsätzlichen Verhaltens liegt dort besonders nahe, wo Autofahrer erfahrungsgemäß nicht mit Menschen rechnen müssen und sich folglich auch nicht auf die Situation einstellen können. Wird also etwa eine Blockade auf einer Autobahnauffahrt durchgeführt, ohne dass eine doppelte Absicherung dahingehend erfolgt, dass keine Autos die Straße benutzen und wird nicht sichergestellt, dass auffahrende Autos die Blockade rechtzeitig wahrnehmen können, liegt der Vorsatz besonders nahe. Anders verhält es sich in Innenstädten, wenn der Straßenabschnitt keine auffällig hohe Geschwindigkeitsfreigabe aufweist. Hier darf auf einen guten Ausgang vertraut werden, wenngleich dies im Ergebnis eine Frage des Einzelfalls ist.
3. Sittenwidrige Schadenszufügung
Ferner muss sich das schadensbegründende Verhalten nach den Umständen, Art und Beweggründen als sittenwidrig darstellen. Für die unter 2. beschriebenen Schäden kann dies im Grundsatz bejaht werden, ohne dass es auf die Rechtmäßigkeit der Versammlung als solcher oder eine Rechtfertigung nach § 240 Abs. 2 StGB ankommt. Schließlich betrifft diese Art der Schadenszufügung nicht die Versammlung als solche, sondern alleine die Art und Weise der Durchführung. Das Sittenwidrigkeitsverdikt folgt dabei aus der potentiellen Lebensgefährlichkeit eines solchen Unfalls und der Betriebsfremdheit des Eingriffes. Selbiges gilt im Übrigen auch für Schäden, die dadurch entstehen, dass Rettungswägen die Straße nicht benutzen können. Auch dieser Vorwurf ist deliktsrechtlich unabhängig von der Durchführung der Blockade als solcher. Anders verhält es sich mit Schäden, die in innerem Zusammenhang mit der Blockade entstehen. Hier ist die Rechtswidrigkeit der Versammlung keine hinreichende, aber zumindest notwendige Voraussetzung der Sittenwidrigkeit, denn eine rechtmäßige Versammlung darf nicht als sittenwidrig angesehen werden. Umgekehrt kann eine Versammlung aber nicht deswegen als sittenwidrig beurteilt werden, weil sie rechtswidrig ist. Dies entspricht auch der ständigen zivilgerichtlichen Rechtsprechung, die insbesondere im Kapitalmarktrecht streng zwischen Rechtmäßigkeit und Sittenwidrigkeit differenziert. Ein Gesetzesverstoß kann eine Haftung unter dem Gesichtspunkt der Schutzgesetzverletzung gem. § 823 Abs. 2 BGB begründen. Fehlt es an der Schutzgesetzeigenschaft oder dem Schutzzweckzusammenhang dürfen diese Erfordernisse nicht durch das Hinzutreten eines entsprechenden Vorsatzes substituiert werden, zumal von § 823 Abs. 2 BGB vor allem Strafgesetze erfasst werden, welche Vorsatz im Grundsatz stets voraussetzen, § 15 StGB.
Was übrige Schäden anlangt, kann man sich in der Sache an den Kriterien zu § 240 Abs. 2 StGB orientieren. Vor allem sticht hervor, dass die Blockade Personen trifft, die nicht Adressaten des aktivistischen Begehrens sind. Nach eigenen, wiederholten Aussagen richten sich die Blockaden an die Politik. Nachteile erleiden indessen zumeist berufstätige Personen, die deswegen schlimmstenfalls ihre Arbeitsstelle verlieren könnten. Etwaige, gut gemeinte, Fernziele können in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. Politische Anliegen sind über die hergebrachten Kanäle in die politische Diskussion einzubringen. Dass die Forderungen der Aktivisten nicht erfüllt werden, ist als demokratische Entscheidung hinzunehmen und kann von den betroffenen Geschädigten ohnehin nicht beeinflusst werden. Besonders tückisch sind diese Proteste auch, weil sie im Voraus nicht angekündigt werden und - wie schon angedeutet - vor allem während des Berufsverkehrs stattfinden. Sie zielen gerade darauf ab, Empörung hervorzurufen und Aufmerksamkeit für das eigene Anliegen herzustellen. Damit werden indes die berechtigten Anliegen der Autofahrer den eigenen politischen Interessen eigenmächtig und ohne Rücksicht auf Verluste untergeordnet. Das Verhalten lässt eine Geisteshaltung erkennen, die auf Vorteilserlangung auf Kosten anderer abzielt und bestehende Regeln bewusst missachtet. Die Aussage, man "kämpfe" auch für die Autofahrer, kann nicht verfangen, weil deren Anerkennung darauf hinausliefe, den betroffenen Autofahrern einen politischen, klimaschützenden Willen aufzuzwingen. Nach diesseitiger Rechtsauffassung sind die Blockaden mithin im Sinne von § 826 BGB sittenwidrig. Häufig wird es aber nicht zur Haftung kommen, weil entsprechende Schäden nicht in den Tätervorsatz aufgenommen worden sind.
III. Rechtsgutsbezogene Haftungsgrundlagen
Anders gelagert sind die Probleme des § 823 Abs. 1 und 2 BGB. Hier muss der entstandene Schaden nicht in den Tätervorsatz aufgenommen werden, aufgrund der erforderlichen Anwendung des § 830 Abs. 1 S. 1 BGB wohl aber die jeweilige Rechtsguts- bzw. Schutzgesetzverletzung (1.). Anschließend fragt sich, ob die Verletzung des Rechtsguts bzw. Schutzgesetzes in adäquat kausaler Weise zur Entstehung eines Schadens geführt hat, insbes., ob sich ein Risiko realisiert, vor dessen Verwirklichung die jeweils verletzte Verhaltensnorm gerade schützen wollte.
1. Haftungsbegründung
a) Rechtsgutsverletzung, § 823 Abs. 1 BGB
Bei Straßenblockaden kommen gleich mehrere Rechtsgüter infrage, die verletzt sein könnten, allen voran das Sacheigentum. Nach - allerdings nicht unbestrittener - Ansicht der Rechtsprechung schützt das Sacheigentum im Sinne der §§ 903 ff BGB auch die Möglichkeit bestimmungsgemäßer Nutzung. Diese wird freilich zeitweilig vollständig aufgehoben, wenn dieses weder vor- noch rückwärts bewegt werden kann, ohne dass der betroffene Autofahrer seinerseits ein Delikt begeht. An dieser Auffassung ist festzuhalten. Schon § 903 BGB enthält neben der Abwehrbefugnis auch das Recht, "mit der Sache nach Belieben zu verfahren", "soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen". Der mögliche Einwand, die Anerkennung einer Rechtsgutsverletzung laufe darauf hinaus, das Sacheigentum dahin zu erweitern, dass es auch äußere Bedingungen der Nutzungen - hier: dem Gemeingebrauch der Straße als subjektives Recht des öffentlichen Recht - schütze, verkennt, dass die äußeren Gegebenheiten und Bedingungen der Nutzung im Falle rechtswidriger Blockaden erfüllt sind. § 903 S. 1 BGB beschränkt die Nutzungsbefugnis aber nur dann, wenn das Gesetz nicht entgegensteht. Das ist nicht der Fall. Aktivlegitimiert ist der jeweilige Eigentümer das blockierten Fahrzeugs. Im Falle geleaster und sicherungsübereigneter Fahrzeuge mag man unter dem Gesichtspunkt der zufälligen Schadensverlagerung dem Dritten gestatten, den Schaden zu liquidieren. Häufig sehen entsprechende vertragliche Abreden aber ohnehin entsprechende Vorausabtretungen vor, die gegebenenfalls ergänzend auszulegen sind, soweit sie unmittelbar nur Unfallschäden betreffen.
Zudem ist für eine Drittschadensliquidation kein Raum, wenn man auch den Besitz als deliktsrechtliches Schutzgut ansieht. Die Rechtsprechung bejaht dies immerhin für den berechtigten Besitz. Mit Blick auf den negatorischen Schutz, der selbst dem fehlerhaften Besitzer gewährt wird (§§ 861 f BGB), ist die Berechtigung des Besitzes indes nicht erforderlich. Auch der unberechtigte Besitz gewährt jedenfalls possesorischen Schutz gegenüber Jedermann. Genau dies zeichnet aber das absolute gegenüber dem nur obligatorischen Recht aus. Warum die obligatorisch berechtigte Nutzung zur Aktivierung des deliktsrechtlichen Schutzes führen soll, erschließt sich dagegen nicht. Dass der Besitz kein Recht im engeren Sinne, sondern eine tatsächliche Position ist, spielt keine Rolle. Schließlich steht auch der Anerkennung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht entgegen, dass die Wahrnehmung und Darstellung einer Person in erster Linie ein tatsächlicher Zustand bzw. Umstand ist. Ausreichend ist der dahingehende negatorische Schutz gegenüber Jedermann.
Unproblematisch sind auch die Fälle der Körperverletzung, wenn ein Rettungswagen nicht durchkommt. Hier reicht es richtigerweise zur Exkulpation nicht aus, wenn die Deliktstäter prinzipiell bereit sind, Rettungswägen passieren zu lassen und sich hierfür einige Personen nicht festkleben. Eine Haftung besteht auch dann, wenn der Rettungswagen gar nicht zur Passierstelle gelangt, weil die übrigen Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet haben. Zwar ist es in der Tat auch Verantwortung der Autofahrer eine Rettungsgasse zu bilden. Doch regelmäßig ist dies schon aus Platzgründen in der Praxis gar nicht möglich. Hier kommt nochmals der Überraschungseffekt von unangekündigten Blockaden zum Tragen. Davon abgesehen läuft diese auf eine Enthaftung wegen Fehlverhalten Dritter hinaus, was grundlegenden deliktsrechtlichen Prinzipien widerspricht (vgl. schon für die Haftungsaussfüllung § 840 Abs. 1 BGB, der ausdrücklich auch Nebentäter erfasst). Die Aktivisten setzen die Ausgangsursache für die Schwierigkeiten, die Autofahrer mit der Bildung einer Rettungsgasse haben und konnten dies auch vorhersehen. Es handelt sich schlicht um ein vermeidbares Risiko, das vor dem Hintergrund lebensgefährlicher Gefahren bei verzögerter Einlieferung von Kranken in das Krankenhaus schlechthin untersagt ist. Ein wie auch immer geartetes haftungsrechtliches Regressverbot gibt es nicht.
Die Aktivisten handeln willentlich im Hinblick auf die Blockade und die Funktionsstörung der Autos. Insofern liegen ohne Weiteres die Voraussetzungen mittäterschaftlichen Handelns vor. Eine Rechtfertigung ist nicht erkennbar und kann insbesondere nicht aus Art. 8 GG folgen. Grundrechte wirken auch nicht mittelbar gegenüber Privaten. Ist ein Gericht der Auffassung, dass eine zivilrechtliche Haftung, vermittelt durch ein klagestattgebendes Urteil (Art. 1 Abs. 3 GG!), gegen Art. 8 GG verstößt, muss es das Gesetz im Rahmen der konkreten Normenkontrolle zur verfassungsrechtlichen Überprüfung vorlegen. Dem Gericht ist es demgegenüber verwehrt, contra legem zu judizieren (vgl. insoweit zutreffend Oberstes Gericht vom 21.01.2022 - Az: 4 BvT 1/22 unter 3) c)) und Tatbestände über Wortlaut, erkennbare Systematik oder Telos hinaus "verfassungskonform" zu interpretieren und so die angebliche mittelbare Drittwirkung von Grundrechten zum Tragen zu bringen. Rechtfertigungsgründe sind nicht erkennbar und es erschließt sich auch nicht, weshalb Art. 8 GG dazu zwingen können sollte, Eingriffe in Rechtsgüter Dritter zu legitimieren. Vielmehr indiziert die Tatbestandsmäßigkeit die Rechtswidrigkeit. Ein zureichender Schutz der Versammlungsfreiheit ist schon dadurch gewährleistet, dass eine deliktsrechtlich relevante Eigentums- oder Besitzverletzung erst dann vorliegt, wenn die Nutzungsmöglichkeit vollständig aufgehoben ist. Nicht haftungsbegründend sind demgegenüber bloße Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen, die wegen eines Aufzugs eintreten.
b) Schutzgesetzverletzung, § 823 Abs. 2 BGB
Auf den ersten Blick erscheint die Herleitung zusätzlich aus § 823 Abs. 2 BGB neben der festgestellten Erfüllung des haftungsbegründenden Tatbestands des § 823 Abs. 1 BGB überflüssig. Dieser Eindruck täuscht, bedenkt man, dass Besitz die tatsächliche Sachherrschaft bedeutet und demnach alleine der jeweilige Autofahrer Besitzer im Sinne des § 854 Abs. 1 BGB sein dürfte. Beifahrern und Mitinsassen kann über § 823 Abs. 2 BGB, § 240 Abs. 1 StGB geholfen werden. Aus zivilistischer Perspektive macht die Unterscheidung zwischen der ersten und zweiten Reihe wertungsmäßig aber keinen Sinn. Es wäre dann nämlich vom Zufall der Eigentumsinhaberschaft oder dem unmittelbaren Besitz abhängig, ob eine Haftung besteht oder nicht. Mag man auch eine gespaltene Normauslegung des § 240 Abs. 1 StGB mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot ablehnen, so ist es unproblematisch möglich auch Dritte in den Schutzbereich einzubeziehen. Denn ein objektiver Verstoß liegt allemal vor, soweit die Blockade verwerflich iSv § 240 Abs. 2 StGB ist. Hiervon ist regelmäßig auszugehen (siehe schon oben II. 3.). Ob ein Gesetz Schutzgesetz ist sowie wer und was davon geschützt wird, ist aber jedenfalls im Kontext des § 823 Abs. 2 BGB eine originär zivilrechtliche Frage und nicht abhängig von der strafrechtlichen Bestimmung des Opfers. Insoweit erscheint eine Abweichung von der Zweite-Reihe-Rechtsprechung haftungsrechtlich vertretbar.
2. Haftungsausfüllung
a) Unmittelbare Schäden
Der funktionsstörungsbedingte Nutzungsausfall kann nach seit jeher streitiger Rechtsprechung gem. § 251 BGB liquidiert werden. Nehmen sich Mitinsassen ein Taxi, das sie vom Stauende wegbefördert, können sie auch die Mietwagenkosten gem. § 249 Abs. 2 BGB ersetzt verlangen. Dem Fahrer wird man demgegenüber nicht gestatten können, das Auto abzustellen, abschleppen zu lassen und die Folgekosten den Täter aufzuerlegen. Dies stellt nämlich ein Verstoß gegen die StVO dar, den der Fahrer nicht für erforderlich halten durfte. Für Unfallschäden ergeben sich keine Besonderheiten. Eine Mitverursachung kraft mitwirkender Betriebsgefahr ist nicht zwingend anzunehmen. Je betriebsfremder der Eingriff ist, umso eher kann die Betriebsgefahr gänzlich zurücktreten, ohne dass es auf das Vorliegen höherer Gewalt iSv § 7 Abs. 2 StVG ankommt, die regelmäßig nicht gegeben sein dürften. Ein Mitverschulden ist anzurechnen, soweit der Unfall auch auf Obliegenheitsverletzungen der Autofahrer zurückgeht. Hier ist ein Nachweis eines Verstoßes gegen die StVO erforderlich.
b) Mittelbare Schäden
Vor dem Hintergrund des Schutzzweckzusammenhangs fraglich erscheint die Ersatzfähigkeit von Verdienstausfällen. Ersatzfähig sind hiernach nur solche Schäden, denen durch das Verhaltensgebot, gegen das die Täter verstoßen haben, vorgebeugt werden sollte. Es ist folglich danach zu fragen, ob das Verbot, Eigentum oder Besitz bzw. im Falle des § 823 Abs. 2 BGB, § 240 Abs. 1 StGB die Freiheit der Willensbildung und -äußerung, nicht zu beeinträchtigen und zu verletzen gerade auch vor Verdienstausfällen schützen soll, die deswegen entstehen, weil man mit dem nicht funktionsfähigen Auto keine Termine wahrnehmen und nicht (rechtzeitig) bei der Arbeit erscheinen kann. Dagegen könnte sprechen, dass die termingerechte Fortbewegung ein allgemeines Lebensrisiko darstellt, das jedem persönlich zugewiesen ist. Man könnte argumentieren, es sei niemand auf das Auto als Fortbewegungsmittel angewiesen. Weil man es dennoch nutze, begebe man sich bewusst in die Gefahr blockiert zu werden. Im Übrigen haftet eine Verdienstchance auch nicht dem Sacheigentum als solches an. Gegen eine solche Sichtweise spricht schon die Überlegung, dass es keine wesentlich zuverlässigeren Verkehrsmittel als das Auto gibt, dessen Nutzung gesetzlich erlaubt ist. Demgegenüber handelt es sich bei Straßenblockaden um betriebsfremde Eingriffe, die nicht untrennbar mit dem Straßenverkehr zusammenhängen, sondern letztendlich in der weit überwiegenden Vielzahl der Fälle schlechterdings rechtswidrig sind. Aus diesem Grund ist auch der Schutzzweckzusammenhang zu bejahen und kann eine Haftung für Verdienstausfall- und Kündigungsfolgeschäden angenommen werden.
3. Fazit
Gem. § 823 Abs. 1 BGB, § 823 Abs. 2 BGB, § 240 Abs. 1 StGB sind die Aktivisten des Kollektivs für Folgeschäden ihrer Blockadeaktion zivilrechtlich haftbar. Dies könnte ein sinnvoller Weg sein, um die Durchsetzung des Rechts zu effektuieren und nur unzureichend motivierte, zum Teil überlastete Staatsanwaltschaften zu entlasten. In der Praxis begegnet man freilich die Schwierigkeit, die Verantwortlichen dingfest zu machen. Hier helfen nur Auskunftsansprüche gegenüber der Polizei, die zur Datenweitergabe für Zwecke des Forderungseinzugs unter Umständen verpflichtet sein kann. Um allerdings eine praktisch handhabbare Umsetzung zu erreichen, geht nach Ansicht des Unterzeichners kein Weg an dem Pooling solcher Forderungen unter Einschaltung professioneller Rechtsdienstleister vorbei, sollten die Blockaden keine temporäre Erscheinung sein und auch milde Strafrechtsfolgen nicht geeignet sein, an das Recht zu erinnern. Allenfalls für besondere Einzelfälle vermag die zivilrechtliche Haftung dann eine spürbare Steuerungsfunktion entfalten können.
IV. Ausblick: Unterlassungsanspruch nebst Ordnungsgeld
Aus diesem Grunde reizvoll erscheint daher auch, mittels einstweiliger Verfügung gegen bekannte Aktivisten vorzugehen und für den Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld in erheblicher Höhe bzw. die Freiheitsentziehung festzusetzen. Freilich problematisch ist das dezentrale Vorgehen der Täter. Eine Zentralfigur ist, soweit ersichtlich, bislang nicht identifiziert worden. Zudem kann auch eine Untersagungsverfügung nur individuellen Rechtsschutz bieten, nicht aber über Orts- und Stadtgrenzen hinweg für einen reibungslosen Verkehr sorgen. Insoweit dürfte nämlich die grundsätzlich indizierte und erforderliche Wiederholungsgefahr widerlegbar sein.
Prof. em. Dr. Roland von Gierke