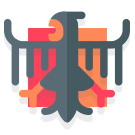Moin!
Beiträge von Magnus Gruensen
-
-
Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der dritte Senat des Obersten Gerichts hat mit Beschluss vom 4. Juli 2021 (3 BvF 1/21) § 10 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1, 2 und 4 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 und § 10 Absatz 1 Satz 1 BEHG für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt, "soweit eine mengenmäßige Begrenzung der tatsächlich erhältlichen Emissionszertifikate in der Einführungsphase und für die Dauer der Anwendung des Preiskorridors nicht stattfindet." Dies ist aktuell aufgrund des § 5 möglich.
Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem Beschluss: "Eine genauere Betrachtung erfordert jedoch die in § 10 Abs. 2 Satz 1, 2 BEHG vorgesehene Einführungsphase. In diesem Zeitraum erfolgt ein Verkauf der Emissionszertifikate zu einem gesetzlich festgelegten Festpreis - eine Bewirtschaftung nach Marktgrundsätzen erfolgt in diesem Zeitraum jedoch gerade nicht. Eine Deckelung der Anzahl der zu verkaufenden Zertifikate findet in dieser Einführungsphase faktisch nicht statt, indem in dieser Phase nach § 5 BEHG ein zusätzlicher Bedarf an Emissionszertifikaten durch einen Zukauf von Emissionszuweisungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten praktisch ohne Begrenzung gedeckt werden kann. Gleiches gilt für die Dauer der Anwendung des Preiskorridors nach § 10 Abs. 2 Satz 4 BEHG, welcher zunächst auf das Jahr 2026 beschränkt ist, jedoch nach § 23 Abs. 1 Satz 5 BEHG auch fortgeführt werden kann."
Mit diesem Entwurf wird die Anzahl der Zertifikate auch in der Einführungsphase bis 2026 definitiv mengenmäßig begrenzt, indem § 5 gestrichen wird. Damit erreichen wir eine verfassungsgemäße Ausgestaltung des BEHG, die Möglichkeit des Zukaufs von Emissionszuweisungen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten entfällt.
Meine Damen und Herren,
die Bundesregierung hofft, dass das nationale Emissionshandelssystem des BEHG in den Sektoren Wärme und Verkehr so bald wie möglich entfallen kann, wenn diese beiden Sektoren auch durch den EU-ETS erfasst werden. Für diese Ausweitung des EU-ETS, und zwar nicht erst 2026 wie mit dem Plan der EU-Kommission "Fit for 55" vorgesehen, setzt sich die Bundesregierung daher weiterhin mit Nachdruck ein.
Auf dem Weg dorthin ist das nEHS aber als Überbrückung notwendig und dient zur gleichen Zeit dem sozialen Ausgleich, welcher mit dem aktuell im Bundesrat liegenden Klimadividendeneinführungsgesetz geschaffen wird. Hierzu äußere ich mich dann in der entsprechenden Debatte hier im Bundestag.
Vielen Dank.
-
Dieses Vorhaben war Teil unseres Wahlprogrammes und Teil des Koalitionsvertrages. Dass es umgesetzt werden soll, hat also nichts mit Angst zu tun. Dass die Staatsregierung in dieser Legislaturperiode nicht mit Aktivität geglänzt hat, steht dabei außer Frage. Ich freue mich umso mehr, dass die Allianz ab Montag neuen Schwung in den Landtag bringen wird.
-
Ja. Das habe ich schon verstanden. Aber wie hat das auszusehen? Wieso gibt es dazu keine Bestimmungen? Kann der Landtagspräsident das ganze dann wahllos ablehnen, wie ihm beliebt? Ich frage mich, wieso dazu absolut keine Regelung vorliegt.
Es liegen doch Bestimmungen vor. Eine inhaltliche Prüfung findet durch den Landtagspräsidenten nicht statt. Dieser hat nur sicherzustellen, dass die Prüfung vorliegt und, wie im Entwurf vorgesehen, darlegt, ob und inwieweit die Vorlage insbesondere der Erreichung der Ziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz oder dem Bayerischen Klimaschutzgesetz entgegensteht oder diese fördert. Soweit Sie weitergehende Bestimmungen für nötig erachten, ist die Staatsregierung gerne bereit, hier im Entwurf nachzujustieren.
-
-
Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Klima- und Umweltschutz, ist eine Querschnittsaufgabe, die nahezu alle politischen Sachbereiche tangiert. Bayern befindet sich wie auch Deutschland im Ganzen in einem großen Umbruch: Das Ziel, die Klimaneutralität zu erreichen, erfordert höchste Anstrengungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Treibhausgasemissionen müssen schnell und effektiv eingespart werden, gleichzeitig darf jedoch nicht vergessen werden, dass auch keine neuen klimaschädlichen Projekte mehr gestartet werden dürfen. Die Politik ist es den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, offenzulegen, welchen Einfluss ihre Gesetzgebung auf das Klima und die Umwelt hat.
Beim Landtage eingebrachte Gesetzesvorlagen sowie Verordnungen der Staatsregierung, die in die Sachbereiche Klima- und Umweltschutz, Energie, Verkehr, Bau, Infrastruktur sowie Land- und Fortwirtschaft fallen, werden mit diesem Gesetzentwurf unter einen Klimavorbehalt gestellt. Dies bedeutet: Den entsprechenden Vorlagen muss bei Einbringung (Gesetzesvorlagen) oder Verkündung (Verordnungen) eine Klima- und Umweltverträglichkeitsprüfung beigefügt werden. Der Landtagspräsident prüft die ordnungsgemäße Umsetzung des Klimavorbehalts, eine qualitative Prüfung findet aber ausdrücklich nicht statt. Der Klimavorbehalt sorgt auch nicht dafür, dass Vorlagen, die der Erreichung der Ziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz oder dem Bayerischen Klimaschutzgesetz entgegenstehen, nicht beschlossen werden oder nicht in Kraft treten dürfen. Er sorgt lediglich für eine Offenlegung der Konsequenzen, die die entsprechende Vorlage für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen hat/hätte.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie um Zustimmung für diesen Gesetzentwurf.
Vielen Dank!
-
 Bayerischer Landtag
Bayerischer LandtagSiebte Wahlperiode
Drucksache VII/XX
G e s e t z e n t w u r fder Staatsregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Bayerischen Verfassung und zur Einführung eines Klimavorbehalts
A) Problem
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Klima- und Umweltschutz, ist eine Querschnittsaufgabe, die nahezu alle politischen Sachbereiche tangiert. Bayern befindet sich wie auch Deutschland im Ganzen in einem großen Umbruch: Das Ziel, die Klimaneutralität zu erreichen, erfordert höchste Anstrengungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Treibhausgasemissionen müssen schnell und effektiv eingespart werden, gleichzeitig darf jedoch nicht vergessen werden, dass auch keine neuen klimaschädlichen Projekte mehr gestartet werden dürfen. Die Politik ist es den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, offenzulegen, welchen Einfluss ihre Gesetzgebung auf das Klima und die Umwelt hat.
B) Lösung
Beim Landtage eingebrachte Gesetzesvorlagen sowie Verordnungen der Staatsregierung, die in die Sachbereiche Klima- und Umweltschutz, Energie, Verkehr, Bau, Infrastruktur sowie Land- und Fortwirtschaft fallen, werden unter einen Klimavorbehalt gestellt. Dies bedeutet: Den entsprechenden Vorlagen muss bei Einbringung (Gesetzesvorlagen) oder Verkündung (Verordnungen) eine Klima- und Umweltverträglichkeitsprüfung beigefügt werden. Der Landtagspräsident prüft die ordnungsgemäße Umsetzung des Klimavorbehalts, eine qualitative Prüfung findet aber ausdrücklich nicht statt. Der Klimavorbehalt sorgt auch nicht dafür, dass Vorlagen, die der Erreichung der Ziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz oder dem Bayerischen Klimaschutzgesetz entgegenstehen, nicht beschlossen werden oder nicht in Kraft treten dürfen. Er sorgt lediglich für eine Offenlegung der Konsequenzen, die die entsprechende Vorlage für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen hat/hätte.
C) Alternativen
Keine. Ein Klimavorbehalt ist aus Gründen der Transparenz notwendig.
D) Kosten
Es fallen keine Kosten an.
-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A n l a g e 1
-
Willkomen! Gerne mal schwupps ins Grünen-Parteiforum gucken und dann auf Discord kommen

-
Die Lösung beim Klimaschutz sind marktwirtschaftliche Ansätze. Das wir jetzt nicht auf Verbote setzen wie Fahrverbote beispielsweise ist doch bekannt.
Warum man dann immer behaupten muss, dass wir Klimaschutz nicht ernst nehmen würden, verstehe ich nicht. Solch Populismus führt dazu, dass die Diskussion sich immer im Kreis dreht.Versteht doch einfach dass der Unterschied zwischen Bürglichen und Linken darin liegen, welche politischen Mittel für den Klimaschutz in Frage kommen. Für uns kommt eben keine Planwirtschaft und es kommen keine Verbote in Frage. Bei den unzähligen Verbotsideen kann man uns gut als Klimablockierer darstellen, dabei lehnen wir halt lediglich die Verbotsvorschläge ab und setzten halt vor allem auf CO2-Bepreisung etc.
Also mich langweilt dieses populistische Framing. Nehmen die Bürgerlichen echt erst den Klimaschutz Ernst, wenn wir Planwirtschaft und Verbotspolitik zustimmen? Nein. Denn wir haben andere Lösungsansätze, und zwar bessere.Da muss man eindeutig der Kollegin beipflichten. Mittlerweile haben wir zum Glück einen (weitgehenden) Konsens über die Existenz der menschengemachten Klimakrise. Dass es unterschiedliche Lösungsansätze gibt, zeigt nur, dass sich alle (die meisten) politischen Parteien Gedanken machen, wie man effektiven Klimaschutz betreiben kann. Über diese Lösungsansätze kann und soll man dann diskutieren.
-
Zu Faul die Tabelle einfach zu übertragen, oder was

Darfst du mir gerne machen, wenn dir das so missfällt


-
-
Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
An die
Präsidentin des BundesratesFrau Ministerpräsidentin
Ricarda Fährmann
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Klimadividende (Klimadividendeneinführungsgesetz – KDEinfG) mit Begründung und Vorblatt.
Federführend ist das Bundesministerium für Klima, Umwelt, Energie und Landwirtschaft.Mit freundlichen Grüßen
Dr. Thomas Merz
Bundeskanzler
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Bundesrat

Drucksache BR/XXX
Gesetzentwurf
der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Klimadividende (Klimadividendeneinführungsgesetz – KDEinfG)
A. Problem und Ziel
Eine CO2-Bepreisung ohne eine sozialpolitische Abfederung belastet einkommensschwächere Haushalte deutlich, was angesichts einer ohnehin steigenden Einkommensungleichheit mit dem Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Konflikt steht.
B. Lösung
Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden zweckgebunden, wie es nach § 7 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz möglich ist. 75 Prozent der Einnahmen werden jährlich zu gleichen Teilen an alle in Deutschland lebenden natürlichen Personen verteilt (für das Jahr 2021 wären das in etwa 32 Euro pro Person, bei 84,4 Millionen Personen). Mit der Auszahlung dieser Klimadividende wird das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) betraut. Die Auszahlung erfolgt jährlich zum 1. März aufgrund der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung aus dem vergangenen Jahr. Hierdurch wird ein sozialer Ausgleich geschaffen. Die restlichen 25 Prozent der Einnahmen werden, wie ursprünglich für alle Einnahmen geplant, dem Energie- und Klimafonds zugeführt.
C. Alternativen
Keine. Ein sozialer Ausgleich ist notwendig. Eine Senkung des Strompreises und der EEG-Umlage sind zu diskutieren.
D. Kosten
Im Jahr 2021 erhält der Energie- und Klimafonds etwa 2,7 Milliarden Euro (75% der geschätzten Einnahmen aufgrund des BEHG im Jahr 2021) weniger als ursprünglich veranschlagt. Es fallen höhere Personalausgaben für das BZSt an.
Anlage 1
Begründung
siehe Vorblatt
-
 Deutscher Bundestag
Deutscher BundestagSiebte Wahlperiode
Drucksache VII/XXX
Antwort
des Bundesministers für Klima, Umwelt, Energie und Landwirtschaft
auf die kleine Anfrage auf Drs. VII/023
Anlage 1
Der Bundesminister
Bemerkungen
Die Kontrolle tierschutzrechtlicher Vorschriften und insoweit auch die Überwachung von Schlachthöfen obliegt den zuständigen Behörden der Länder. Für eine rechtliche Prüfung der Videoüberwachung an Schlachthöfen ist die Klärung der aufgeworfenen Fragen erforderlich.
-
 Deutscher Bundestag
Deutscher BundestagSiebte Wahlperiode
Drucksache VII/XXX
Antwort
des Bundesministers für Klima, Umwelt, Energie und Landwirtschaft
auf die kleine Anfrage auf Drs. VII/035
Anlage 1
Der Bundesminister
-
Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
An die
Präsidentin des BundesratesFrau Ministerpräsidentin
Ricarda Fährmann
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes mit Begründung und Vorblatt.
Federführend ist das Bundesministerium für Klima, Umwelt, Energie und Landwirtschaft.Mit freundlichen Grüßen
Dr. Thomas Merz
Bundeskanzler
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Bundesrat

Drucksache BR/XXX
Gesetzentwurf
der Bundesregierung
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes
A. Problem und Ziel
Die Gesetzesänderung dient dazu, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 (1 BvR 2656/18; 1 BvR 78/20; 1 BvR 96/20; 1 BvR 288/20) umzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass § 3 Absatz 1 Satz 2 und § 4 Absatz 1 Satz 3 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 in Verbindung mit Anlage 2 mit den Grundrechten unvereinbar sind, soweit eine den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende Regelung über die Fortschreibung der Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr 2031 fehlt. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2022 die Fortschreibung der Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr 2031 zu regeln. Zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen weist das Bundesverfassungsgericht in der Begründung der Entscheidung generell – und damit auch für die Minderungsziele bis zum Jahr 2030 darauf hin, dass Klimaschutzmaßnahmen, die gegenwärtig unterbleiben, in Zukunft unter möglicherweise noch ungünstigeren Bedingungen ergriffen werde müssten und dann Freiheitsbedürfnisse und -rechte weit drastischer beschneiden würden.
B. Lösung
I. Der Entwurf ändert die nationalen Klimaschutzziele. Für das Jahr 2040 gilt ein neues nationales Klimaschutzziel von mindestens 90 Prozent Reduktion im Vergleich zu 1990. Für die Jahre 2030, 2040 und 2045 wird zudem festgelegt, welche Beiträge im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft erreicht werden sollen.
II. Die im Bundes-Klimaschutzgesetz bereits festgelegten Jahresemissionsmengen der Sektoren nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 werden für die Jahre 2023 bis 2030 neu festgelegt, um die Erreichung des ambitionierten nationalen Klimaschutzziels von mindestens 65 Prozent im Jahr 2030 sicherzustellen. Für die Jahre von 2031 bis 2040 werden in Anlage 3 sektorübergreifende jährliche Minderungsziele festgelegt. Aus diesen ergibt sich, wie vom Bundesverfassungsgericht nahegelegt, ein konkreter Minderungspfad bis zum Jahr 2040. Spätestens im Jahr 2032 wird die Bundesregierung einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen, um auch die weiteren jährlichen Minderungsziele bis zur Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 gesetzlich festzulegen. Die sektorübergreifenden jährlichen Minderungsziele bilden den Rahmen für die nachfolgende Festlegung der sektorscharfen Jahresemissionsmengen durch Rechtsverordnung im Jahr 2024 (für die Jahresemissionsmengen von 2031 bis 2040) und im Jahr 2034 (für die Jahresemissionsmengen von 2041 bis 2045).III. Zahlreiche Länder haben sich selbst ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt und eine Klimaneutralstellung der eigenen Verwaltung und des Landes in den eigenen Klimaschutzgesetzen festgehalten. Diese sehen teilweise vor, nicht vermeidbare Treibhausgasemissionen der staatlichen Behörden durch geeignete Klimaschutzmaßnahmen zu kompensieren. Der Vorteil von Kompensationsprojekten im eigenen Land, beispielsweise durch Renaturierung bewirtschafteter Feuchtgebiete (Moore), Nutzung von Wäldern und Böden, besteht insbesondere darin, dass sie im Unterschied zu Maßnahmen in Drittländern nicht Gefahr laufen, als Green Washing diskreditiert zu werden. Diese direkt im Land durchgeführten Kompensationsmaßnahmen werden durch entsprechende Landnutzungsänderungen als werthaltige Zertifikate der Klimaneutralstellung der Verwaltung oder des Landes angerechnet. Gleichzeitig fallen diese Projekte jedoch auch in den Geltungsbereich von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/841 und sind verpflichtend im Rahmen der nationalen Berichterstattung an die EU als Treibhausgasemissionsminderung zu melden. In der Folge kommt es zu einer Doppelzählung. Zum einen reklamieren die Länder die Emissionsminderung im Rahmen der klimaneutralen Staatsverwaltung für sich und zum anderen verbucht der Bund die Emissionsminderung bei der nationalen Berichterstattung im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/841.
Als Lösung wird eine zentrale Registrierung von Emissionsminderungen der Länder, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2018/841 fallen, und die Löschung von europäischen Emissionsrechten in gleicher Höhe durch den Bund, vorgeschlagen. Der Bund könnte entweder einen Teil der Emissionszuweisungen aus dem Non-ETS Sektor oder Emissionsberechtigungen aus dem ETS Sektor löschen und der freiwilligen Minderungsaktivität zuschreiben. Ein Vorteil dieser Lösung wäre, dass Klimaschutzprojekte in den Ländern, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2018/841 fallen, ohne Gefahr einer Doppelzählung durchgeführt werden könnten
IV. Darüber hinaus wird die Rolle des Expertenrats für Klimafragen gestärkt.
V. Indem das Gesetzgebungsvorhaben schon kurz- bis mittelfristig zu mehr Klimaschutzmaßnahmen führen wird, verhindert es eine unverhältnismäßige Verlagerung der Treibhausgasminderungslasten und damit einhergehenden Freiheitseinbußen in die Zukunft und auf spätere Generationen. Die frühzeitige Festlegung von nationalen Klimaschutzzielen, Jahresemissionsmengen und jährlichen Minderungszielen sorgt zugleich für mehr Klarheit, wie sich die nach Artikel 20a des Grundgesetzes notwendige Reduktion von Treibhausgasemissionen bis hin zur Netto-Treibhausgasneutralität über die Zeit verteilen wird. Damit bietet das Gesetzgebungsvorhaben für Gesellschaft und Wirtschaft mehr Orientierung und Planungssicherheit für die erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse.C. Alternativen
Keine. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber verpflichtet, die Fortschreibung der Minderungsziele für Zeiträume ab dem Jahr 2031 zu regeln. Die weiteren im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen stehen hiermit in unmittelbarem Zusammenhang.
D. Kosten
Der Gesetzentwurf begründet weder unmittelbaren zusätzlichen Haushaltausgaben ohne Erfüllungsaufwand noch andere Erfüllungsaufwände. Infolge des Gesetzes entstehen gegenüber dem Klimaschutzgesetz 2019 für die Treibhausgasminderungspflichten zusätzliche rechnerische Gesamtkosten für die Volkswirtschaft für die Jahre 2023 bis 2035 von 12.819 Millionen EUR. Für den Bereich LULUCF betragen die Kosten bis 2030 etwa 3.540 Millionen Euro.
Anlage 1
Begründung
siehe Vorblatt
-
– Pressemitteilung –
IIIIIIIII "Raffiniert!" - Kampagne des BMIJ und BMKUEL zur Zuckerreduktion gestartet
Die Bundesminister Magnus Gruensen und Elias Jakob Lewerentz brachen am frühen Dienstagmorgen des 27. Juli nach Hauzenberg in den Landkreis Passau auf. Dort besuchten sie eine Grundschule kurz vor den bald auch in Bayern beginnenden Sommerferien, um mit den Schülerinnen und Schülern der 3b die Kampagnenarbeit "Raffiniert!" zu beginnen, die das BMKUEL und das BMIJ in den vergangenen Wochen gemeinsam konzipiert haben. "Raffiniert!" ist das vom BMKUEL geförderte Projekt zur Ernährungsbildung, um die Zuckerreduktionsstrategie der Bundesregierung gerade auch dort zu diskutieren, wo sie am ehesten im Einsatz gebraucht wird - in den Schulen, den Kindertagesstätten vor Ort in den Kommunen und Gemeinden. Die Grundschule in Hauzenberg ist bereits seit mehreren Jahren sehr engagiert im Bereich gute und gesunde Schule und hat sich die Gesundheitsförderung der kleinen Schülerinnen und Schülern besonders auf die Fahne geschrieben. Daher war es für die Bundesminister naheliegend dort den Kick-Off der neuen Bildungskampagne zu starten. Gemeinsam mit der Diplom-Ökotrophologin und Bildungsreferentin Anja Leiterhuber-Becker, die das Programm "Raffiniert!" leiten wird, verbrachten die Bundesminister drei Stunden mit den Drittklässlern. Auf spielerische Art und Weise wurden in Lebensmitteln verschiedene Zucker identifiziert und nach zuckerfreien Alternativen geschaut. Leiterhuber-Becker verteilte Bildungsmaterialien und motivierte die Kleinen dazu in den nun anstehenden Sommerferien ein "Zuckertagebuch" zu führen. Nach den Ferien können so jeder seinen eigenen Zuckerkonsum kritisch hinterfragen. Dabei wurden auch noch mal die Spielregeln einer guten und gesunden Ernährung in den Vordergrund gestellt.Zur Information: Die Kampagne "Raffiniert!" ist ein Projekt des BMKUEL und des BMIJ im Rahmen der Zuckerreduktionsstrategie der Bundesregierung. Es ist vorerst bis 2024 mit finanziellen Ressourcen ausgestattet. Am Ende soll ein Projektbericht angefertigt werden. Die Hochschule Anhalt in Köthen und die Professorin Margot Dasbach sollen die Kampagne wissenschaftlich begleiten und zugleich Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung für eine gelungene und umfassende Zuckerreduktion bei Kindern und Jugendlichen formulieren. Die Kampagne "Raffiniert!" soll aus einem Team von fünfzehn Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten bestehen, die die Schulen vor Ort aufsuchen und dort über Zucker und Zuckerreduktion im Alltag von Kindern bis 12 Jahren erzählen. Mithilfe von Schulungen sollen außerdem weitere pädagogische Fachkräfte Zusatzqualifikationen im Bereich Ernährungsbildung besuchen können, sodass die Kampagne "Raffiniert!" bis 2024 genug Lehrkräfte ausgebildet hat, damit die Ziele einer besseren Ernährungsbildung, insbesondere hinsichtlich des Zuckerkonsums, auch danach weiter an die Schülerinnen und Schüler vermittelt werden können.
Nach dem belebten Bildungsvormittag, den die Bundesminister gemeinsam mit den Drittklässlern bei einem fairen und gesunden Frühstück beendeten, ging es für Magnus Gruensen und Elias Jakob Lewerentz im Büro der Bürgermeisterin Hauzenbergs weiter. Gruensen gratulierte ihr herzlich zur Auszeichnung als Fairtrade-Kommune und ging dann im Gespräch mit der Bürgermeisterin insbesondere auf das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ein und betonte, dass gerade eine proaktive Mitarbeit der Kommunen wünschenswert sei, um die angepassten Klimaziele auch wirklich zu erreichen. Das nötige Rüstzeug für die Kommunen sei da, es müsse nur konsequent genutzt werden.
Am Ende des Tages gaben beide Bundesminister noch ein Statement ab.
Bundesminister Magnus Gruensen: "Es zeigt sich, dass unsere Grundschülerinnen und Grundschüler sehr aufgeschlossen sind, was das Thema Ernährungsbildung angeht. Hier wird noch einmal klar: Kinder kann man sehr gut erreichen, wenn man an den richtigen Stellen ansetzt und sie schon früh mit dem Verbraucherschutz in Begegnung bringt. "Raffiniert!" ist, wie der Name schon sagt, ein raffiniertes Programm, um über Zuckerreduktion und gesunde Ernährung zu informieren. Daran werden wir anknüpfen."
Bundesminister Elias Jakob Lewerentz: "Am Ende dieses Tages bin ich noch einmal mehr bestätigt darin, dass es wichtig ist, eine effiziente Zuckerreduktionsstrategie immer weiter zu entwickeln. Mit "Raffiniert!" haben wir einen ersten wichtigen Bestandteil und wir haben heute in der Grundschule auch noch einmal erlebt, wie wichtig es ist über Zucker, Zuckerkonsum, Zuckerreduktion und eine gute, gesunde und ausgewogene Ernährung zu informieren. Ernährungsbildung muss stärker in den Vordergrund gerückt werden. Dafür haben die Schulen und dazu sollten sie auch genutzt werden. Das BMIJ wird da weiterhin beratend tätig werden. Schließlich ist die Aufklärung über unterschiedliche Zucker und eine vernünftige Ernährungsbildung auch im Sinne eines proaktiven Verbraucherschutzes. Verbraucherschutz ist im BMIJ angesiedelt und ein ganz wichtiges Thema, dem wir viel häufiger Aufmerksamkeit verschaffen sollten. Umso mehr freue ich mich, dass uns heute ein guter Auftakt gelungen ist. Ich habe mit Magnus Gruensen da einen super engagierten und motivierten Kollegen im BMKUEL an meiner Seite. Wir haben auf der Hinfahrt hier in den Landkreis Passau schon über mögliche weitere Anknüpfungspunkte gesprochen. Ich bin mir sicher, dass wir im Bereich "Raffiniert!" und der Zuckerreduktionsstrategie ganz allgemein noch weitere gute Erfolge erzielen werden."
-
Herr Präsident!
Ich bitte um Fristverlängerung.
-
Frau Präsidentin!
Nachdem der Entwurf auf Drucksache BR/063 nun doch angenommen wurde, bitte ich um Abänderung des Titels des vorliegenden Entwurfs zu "Zweites Gesetzes zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes". Vielen Dank.
Vielen Dank für den Hinweis Herr Bundesminister, ich komme dem unverzüglich nach.
Vielen Dank. Zudem entfallen daher auch jeweils die Ausführungen auf den Ziffern I und III in A und B im Vorblatt sowie die Nummern 1 und 5 in Artikel 1.
-
Klima, hust hust
Bitte um Verzeihung, dass ich keine Fristverlängerung beantragt habe. Habe es einfach nicht geschafft. Hoffe, dass ich morgen dazu komme. -