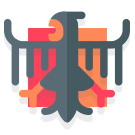OBERSTES GERICHT
– 3 BvT 3/22 –
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Verfahren
zur verfassungsrechtlichen Prüfung,
über den Antrag festzustellen,
dass § 166 StGB in der Fassung des Artikel 19 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) mit Artikel 103 Absatz 2 GG unvereinbar und nichtig ist.
Antragstellerin:
Frau Dr. jur. Irina Christ MdB,
97078 Würzburg-Versbach
hat das Oberste Gericht – Dritter Senat –
unter Mitwirkung der Richter
Vizepräsident Neuheimer,
Geissler
am 25. September 2022 einstimmig beschlossen:
§ 166 StGB in der Fassung des Artikel 19 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) ist mit Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes vereinbar.
G r ü n d e :
A.
Die Popularklage der in Würzburg wohnhaften Antragstellerin, die zugleich Mitglied des Deutschen Bundestages ist, wendet sich gegen § 166 des Strafgesetzbuches (StGB). Die Antragstellerin rügt dabei einen Verstoß der angegriffenen Norm gegen das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot aus Art. 103 Abs. 2 GG.
I.
1. Der Wortlaut der Norm, gegen die sich die Popularklage wendet, lautet wie folgt:
㤠166 StGB РBeschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen
(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.“
II.
Die Antragstellerin hält die Klage mit ihrem Schriftsatz vom 21. August 2022 für zulässig (1.) und begründet (2.).
1. Art. 103 Abs. 2 GG gewährleiste, dass nur eine Tat bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tatbegangen wurde. Dies verpflichte den Gesetzgeber, die Voraussetzungen der Strafbarkeit so genau zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände für den Normadressaten schon aus dem Gesetz selbst zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln und konkretisieren lassen (vgl. BVerfGE 73, 206 <234>; 75, 329 <340>; 78, 374 <381 f.>; 105, 135).
Es müsse einzig und allein vom Handeln der Bürgerinnen und Bürger - und nicht etwa von den Strafgerichten - abhängen, ob eine Tat strafrechtlich zu verfolgen sei. Art. 103 Abs. 2 GG sorge dafür, dass allein der Gesetzgeber abstrakt-generell über die Strafbarkeit entscheiden könne (BVerfGE 75, 329 <341>; 78, 374 <382>; 95, 96 <131>; 105, 135). Dieser sei deshalb von Verfassungs wegen verpflichtet, die Grenzen der Strafbarkeit selber zu bestimmen.
2. Unter Anwendung dieser Maßstäbe verstoße § 166 StGB gegen das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot aus Art. 103 Abs. 2 GG.
a) Schon der Term "beschimpfen" werde den Anforderungen des strafrechtlichen Bestimmtheitsgebotes nicht gerecht, da nicht ersichtlich sei, wann ein Beschimpfen eine hinreichende Qualität aufweise, um den Tatbestand der angegriffenen Norm zu erfüllen. Dies hinge im Einzelfall von der Bewertung des Gerichts ab. Es würde den Bürgerinnen und Bürgern somit unmöglich gemacht, ihre Äußerungen so auszurichten, dass eine Strafverfolgung unterbleibt.
b) Auch die Formulierung "öffentliche[r] Frieden" sei zu vage, da es von der Interpretation des Begriffes abhänge, ob der Tatbestand des § 166 StGB im Einzelfall erfüllt sei und der Begriff des "öffentliche[n] Friedens" keiner eindeutigen Definition zugänglich sei.
c) Die angegriffene Norm sei daher verfassungswidrig und für nichtig zu erklären. Eine bloße Unvereinbarkeitserklärung komme nicht in Betracht, da die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben seien, da die Nachteile, die durch das Außerkrafttreten der Norm entstünden nicht eindeutig gegenüber den Nachteilen eines befristeten Weitergeltens der angegriffenen Norm überwögen.
III.
Zur Stellungnahme berechtigt waren § 34a Abs. 2 Nr. 1 OGG der Deutsche Bundestag und der Bundesrat. Beide zur Stellungnahme berechtigten Organe verzichteten auf eine solche.
B.
Der Antrag ist zulässig.
1. Das Oberste Gericht ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 17 OGG für die Popularklage zuständig. Der Antrag genügt auch den Begründungsanforderungen. Die Norm, die verletzt sein soll, ist bezeichnet und die behauptete Rechtsverletzung substantiiert dargelegt worden.
2. Die Antragstellerin ist auch antragsbefugt. Sie zweifelt die sachliche Vereinbarkeit der angegriffenen Norm mit dem Grundgesetz an. Weiter hält sie die angegriffene Norm für nichtig. Dies indiziert das besondere objektive Klarstellungsinteresse (BVerfGE 6, 104 <110>; 52, 63 <80>; 88, 203 <334>; 96, 133 <137>; 100, 249 <257>; 101, 1 <30>; 103, 111 <124>; 106, 244 <250 f.>; 108, 169 <178>; 110, 33 <44 f.>; 113, 167 <193>; 119, 394 <409 f.>; 127, 293 <319>; 128, 1 <32>; st. Rspr.). Ein solches Interesse liegt schon dann vor, wenn der Antragsteller von der Unvereinbarkeit der Norm mit höherrangigem Recht überzeugt ist (vgl. OGE 2, 3 <6>; 17 <20>; 80, <95>; st. Rspr.).
C.
§ 166 StGB ist mit dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot aus Art. 103 Abs. 2 GG vereinbar.
I.
1. a) Art. 103 Abs. 2 GG verpflichtet den Gesetzgeber, die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln lassen. Diese Verpflichtung dient einem doppelten Zweck. Einerseits geht es um den rechtsstaatlichen Schutz des Normadressaten: Jedermann soll vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit Strafe bedroht ist. Anderseits soll sichergestellt werden, dass nur der Gesetzgeber über die Strafbarkeit entscheidet. Insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt verwehrt, über die Voraussetzungen einer Bestrafung selbst zu entscheiden (vgl. BVerfGE 71, 108 <114>).
Das schließt nicht eine Verwendung von Begriffen aus, die in besonderem Maße der Deutung durch den Richter bedürfen. Auch im Strafrecht steht der Gesetzgeber vor der Notwendigkeit, der Vielgestaltigkeit des Lebens Rechnung zu tragen. Müsste er jeden Straftatbestand stets bis ins Letzte ausführen, anstatt sich auf die wesentlichen Bestimmungen über Voraussetzungen, Art und Maß der Strafe zu beschränken, bestünde die Gefahr, dass die Gesetze zu starr und kasuistisch würden und dem Wandel der Verhältnisse oder der Besonderheit des Einzelfalls nicht mehr gerecht werden könnten (vgl. BVerfGE 126, 170 <195>; 143, 38 <54 f. Rn. 40>; 153, 310 <341 Rn. 76>). Das Bestimmtheitsgebot bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber gezwungen wäre, sämtliche Straftatbestände ausschließlich mit unmittelbar in ihrer Bedeutung für jedermann erschließbaren deskriptiven Tatbestandsmerkmalen zu umschreiben. Es schließt die Verwendung wertausfüllungsbedürftiger Begriffe bis hin zu Generalklauseln im Strafrecht nicht von vornherein aus (vgl. BVerfGE 92, 1 <12>; 126, 170 <196>; 143, 38 <55 Rn. 41>; 153, 310 <341 Rn. 77>). Wegen der Allgemeinheit und Abstraktheit von Strafnormen ist es ferner unvermeidlich, dass in Grenzfällen zweifelhaft sein kann, ob ein Verhalten schon oder noch unter den gesetzlichen Tatbestand fällt oder nicht. Dann genügt, wenn sich deren Sinn im Regelfall mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden ermitteln lässt und in Grenzfällen dem Adressaten zumindest das Risiko der Bestrafung erkennbar wird (vgl. BVerfGE 41, 314 <320>; 71, 108 <114 f.>; 73, 206 <235>; 85, 69 <73>; 87, 209 <223 f.>; 92, 1 <12>).
b) Welchen Grad an gesetzlicher Bestimmtheit der einzelne Straftatbestand haben muss, lässt sich nicht allgemein festlegen (vgl. BVerfGE 126, 170 <196>; 143, 38 <55 Rn. 41>; 153, 310 <341 Rn. 77>). Deshalb ist im Wege einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung möglicher Regelungsalternativen zu entscheiden, ob der Gesetzgeber seinen Verpflichtungen aus Art. 103 Abs. 2 GG im Einzelfall nachgekommen ist. Zu prüfen sind die Besonderheiten des jeweiligen Straftatbestands einschließlich der Umstände, die zu der gesetzlichen Regelung führten (vgl. BVerfGE 28, 175 <183>), wobei der Gesetzgeber die Strafbarkeitsvoraussetzungen umso genauer festlegen und präziser bestimmen muss, je schwerer die von ihm angedrohte Strafe ist (vgl. BVerfGE 75, 329 <342>; 126, 170 <196>; 153, 310 <341 Rn. 75>).
2. a) Ein Rückgriff des Strafgesetzgebers auf den „öffentlichen Frieden“ als Tatbestandsmerkmal ist nicht aus sich heraus verfassungsrechtlich unbedenklich. Die Tatsache, dass der öffentliche Friede bei hinreichend begrenztem Verständnis ein geeignetes Schutzgut der Strafgesetzgebung sein kann, besagt noch nicht, dass auf diesen Begriff ohne weiteres auch als Tatbestandsmerkmal zurückgegriffen werden darf. Verstanden als Tatbestandsmerkmal, das eigenständig strafbegründend wirkt, wirft der Begriff des öffentlichen Friedens vielmehr Zweifel hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgebot auf. Er ist vielfältig offen für unterschiedliche Deutungen, die auf ein schwer zu fassendes subjektives Kollektivgefühl der Unsicherheit abstellen und dabei anfällig sind für ein Verständnis, das der grundlegenden Bedeutung der Freiheitsrechte in der grundgesetzlichen Ordnung nicht hinreichend Rechnung trägt. Entsprechend steht die Literatur dem strafrechtlichen Rückgriff auf den öffentlichen Frieden weithin kritisch gegenüber (vgl. Fischer, Öffentlicher Friede und Gedankenäußerung, 1986, S. 630 ff.; Enders/Lange, JZ 2006, S. 105 <108>; Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 2005, S. 90 ff., 282 ff.; Junge, Das Schutzgut des § 130 StGB, 2000, S. 26 ff.). Als allein strafbegründendes Tatbestandsmerkmal oder als ergänzendes Tatbestandsmerkmal in Straftatbeständen, die nicht schon durch andere Tatbestandsmerkmale grundsätzlich tragfähige und hinreichend begrenzte Konturen erhalten, kann dessen Vereinbarkeit mit Art. 103 Abs. 2 GG Bedenken ausgesetzt sein (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 04. November 2009 - 1 BvR 2150/08 -, Rn. 93).
b) Demgegenüber bestehen gegen das Tatbestandsmerkmal des öffentlichen Friedens dann keine Bedenken, wenn die vom Gesetzgeber als strafwürdig beurteilte Störung des öffentlichen Friedens durch andere, ihrerseits hinreichend bestimmte Tatbestandsmerkmale konkret umschrieben wird, die bereits für sich die Strafandrohung jedenfalls grundsätzlich zu tragen vermögen. Wird in einem solchen Fall der öffentliche Friede als zusätzliches Tatbestandsmerkmal herangezogen, lässt sich dessen Inhalt aus einem solchen Kontext inhaltlich näher bestimmen. Der öffentliche Friede ist dann als ein Tatbestandsmerkmal zu verstehen, dessen Inhalt sich aus dem jeweiligen Normenzusammenhang je eigens bestimmt. Es hat dabei nur noch die Funktion eines Korrektivs. Grundsätzlich begründet bereits die Verwirklichung der anderen Tatbestandsmerkmale die Strafbarkeit, bei deren Erfüllung auch die Störung des öffentlichen Friedens (beziehungsweise die Eignung hierzu) vermutet werden kann. Eigenständige Bedeutung hat es nur in atypischen Situationen, wenn diese Vermutung aufgrund besonderer Umstände nicht trägt. Bei dem öffentlichen Frieden handelt es sich insoweit nicht um ein strafbegründendes Tatbestandsmerkmal, sondern um eine „Wertungsformel zur Ausscheidung nicht strafwürdig erscheinender Fälle“ (vgl. Fischer, StGB, 56. Aufl. 2009, § 130 Rn. 14b). Es ist damit ein Korrektiv, das es insbesondere erlaubt, auch grundrechtlichen Wertungen im Einzelfall Geltung zu verschaffen (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 04. November 2009 - 1 BvR 2150/08 -, Rn. 94).
II.
Nach diesen Maßstäben bestehen gegen die Bestimmtheit des § 166 StGB hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale des Beschimpfens (1.) und der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens (2.) keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.
1. Das Tatbestandsmerkmal der "Beschimpfung" steht mit dem Bestimmtheitsgebot aus Art. 103 Abs. 2 GG im Einklang.
a) Es ist schon von seiner sprachlichen Fassung her hinreichend deutlich und begrenzt, um im Sinne der Anforderungen der Rechtsprechung auslegungsfähig zu sein. Die Frage, wie eng oder weit dieser Begriff im Kontext der Norm auszulegen sind, ist eine Frage ihrer Anwendung. Die Norm selbst ist hinsichtlich dieses Merkmals nicht in einer Weise offen, dass sie die Strafbarkeit insoweit ohne vorgegebenes Maß in die Hände der Strafjustiz legen würde. Die Einschätzung, ob eine Aussage tatsächlich als Beschimpfung im Sinne des § 166 StGB zu werten sein könnte, ist dem mündigen Bürger im Regelfall zuzutrauen. Jedenfalls aber, kann er im Wissen über das Bestehen der angegriffenen strafrechtlichen Norm, im Zweifelsfall das Risiko einer Bestrafung erkennen und sein Handeln demnach ausrichten.
Zwar mag der Begriff der Beschimpfung, wie die Antragstellerin ausführt, grundsätzlich einer besonders weiten Auslegung zugänglich sein. Jedoch entspricht eine solche erkennbar nicht dem Regelungswillen des Gesetzgebers. Dies zeigt sich schon dadurch, dass die Beschimpfung geeignet sein muss, den öffentlichen Frieden zu stören. Eine lediglich kritisierende oder geringfügig abschätzige Bemerkung reicht hierfür offenkundig und für jedermann erkennbar nicht aus.
b) Zur Wahrung des Bestimmtheitsgebotes ist es insbesondere gerade nicht erforderlich, dass der Gesetzgeber eine konkrete Qualität der Beschimpfung normativ erfasst. Die Beurteilung, ob eine Aussage als Beschimpfung zu werten ist, muss oftmals unter Berücksichtigung der Umstände, in denen diese getätigt wurde, vorgenommen werden. Nur bei korrekter Würdigung der Begleitumstände kann abschließend ermittelt werden, ob eine Äußerung tatsächlich als beschimpfend zu qualifizieren ist. Weiter konkretisiert der Gesetzgeber die Grenze zur Beschimpfung dahingehend, dass diese zur Störung des öffentlichen Friedens geeignet sein muss; die Beschimpfung muss entsprechend eine gewisse, nicht nur geringe Qualität aufweisen. Das Festschreiben einer noch konkreteren, zur Erfüllung des Tatbestandes erforderlichen Qualität der Beschimpfung würde den realen Lebensumständen nur unzureichend Rechnung tragen und im Zweifelsfalle dazu führen, dass das eigentliche Ziel des Gesetzgebers verfehlt würde. Es begegnet dabei auch keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass das Tatbestandsmerkmal der Beschimpfung, wie dargestellt, im konkreten Einzelfall in beträchtlichem Maße von der Deutung der Richterin oder des Richters abhängen wird (siehe I. 1. a); dies lässt sich vorliegend aufgrund der vorzunehmenden Abstraktion schwerlich vermeiden.
2. Auch das Tatbestandsmerkmal der Störung des öffentlichen Friedens ist im Kontext des § 166 Abs. 1, 2 StGB mit dem Bestimmtheitsgebot vereinbar.
a) Das Tatbestandsmerkmal der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens bedarf zwar in Bezug auf das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG einer näheren Konkretisierung durch die weiteren Tatbestandsmerkmale (vgl. BVerfGE 124, 300 <339 ff.>). Der Gesetzgeber durfte jedoch schon die Beschimpfung des Inhaltes eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses an sich als eine strafwürdige und hinreichend bestimmt erfasste Störung des öffentlichen Friedens ansehen (siehe 1.). Aus diesem Kontext heraus wird die Störung des öffentlichen Friedens auch als Tatbestandsmerkmal bestimmbar: Sie besteht in einem Absenken der Schwelle der Gewaltbereitschaft und in der bedrohenden Wirkung, die solchen Äußerungen vor dem speziellen Hintergrund der weltweit bestehenden zwischenreligiösen Konflikte und der Gefahr gewalttätiger oder terroristischer Taten aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen, wie sie in der Vergangenheit vorgekommen sind, in der Regel zukommt.
b) Die Wahrung des öffentlichen Friedens ist indes als Gewährleistung von Friedlichkeit zu verstehen. Ziel ist der Schutz vor Äußerungen, die ihrem Inhalt nach erkennbar auf rechtsgutgefährdende Handlungen hin angelegt sind. Die Wahrung des öffentlichen Friedens bezieht sich insoweit auf die Außenwirkungen von Meinungsäußerungen etwa durch Appelle oder Emotionalisierungen, die bei den Angesprochenen Handlungsbereitschaft auslösen oder Hemmschwellen herabsetzen oder Dritte unmittelbar einschüchtern (vgl. BVerfGE 124, 300 <335>). Eine Störung ist etwa dann anzunehmen, wenn ein verbreiteter Inhalt (§ 11 Abs. 3 StGB) über die Überzeugungsbildung hinaus mittelbar auf Realwirkungen angelegt ist und etwa in Form von Appellen zum Rechtsbruch, aggressiven Emotionalisierungen oder durch Herabsetzung von Hemmschwellen rechtsgutgefährdende Folgen unmittelbar auslösen kann (vgl. BVerfGE 124, 300 <333>). Eine solche Wirkung kann schon grundsätzlich bei Verwirklichung der weiteren Tatbestandsmerkmale vermutet werden. Das Tatbestandsmerkmal des öffentlichen Friedens gemäß § 166 Abs. 1, 2 erlaubt es dabei jedoch, atypischen Situationen im Sinne der Meinungsfreiheit Rechnung zu tragen (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 04. November 2009 - 1 BvR 2150/08 -, Rn. 95).
D.
Präsidentin Christ-Mazur und Richterin Siebert haben sich nach § 11 Abs. 1, 3 OGG selbst abgelehnt und waren daher nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt.
Die Entscheidung ist unanfechtbar.
Neuheimer | Geissler